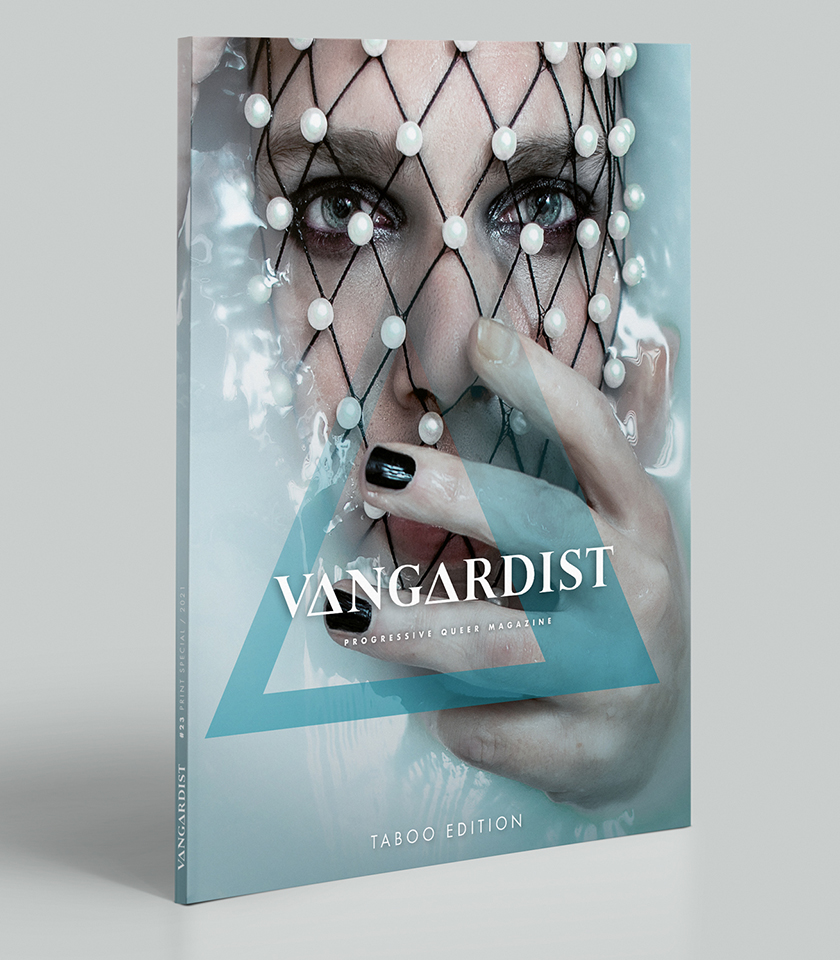Bilder von Körpern begegnen uns, wo immer wir auch hinsehen. Überall werden sie bewertet. Auf Instagram: Zahnpastalächeln, Models mit glatter Haut und schlanken Körpern. Dass die Haare dann auch noch perfekt sitzen, ist fast schon eine Frechheit. Besonders beliebt sind die Posed-/Unposed-Bilder von dünnen Menschen, die sich eine Speckfalte abzwicken, um so unangepasst wie möglich zu wirken und auch auf den Zug der Body-Positivity aufspringen zu können. Spoiler Alert: Diese Körper sind immer noch normschön. Auf Grindr: “No Fats, no Femmes, no Asians, no Blacks” – eine diskriminierende Reduktion aufs Äußere. In der Nachrichten-App unseres Vertrauens: Madeleine Darya Alizadeh, besser bekannt als @dariadaria, löst einen Shitstorm aus, weil sie einen Safe Space für FLINTA schaffen möchte, damit diese sich trauen, in Badebekleidung frei schwimmen zu gehen, ohne dass ihre Körper kommentiert werden. Zwischen den Absätzen des Artikels immer wieder Werbung für Abnehmpillen. Im Real Life: Keine Süßigkeiten vor anderen zu essen, damit niemand denkt: „Na klar, das hat die/der jetzt auch noch gebraucht.“ Und seien wir ehrlich – wenn’s so ausgedrückt wird, hat man noch Glück gehabt.
Was all diese Beispiele gemeinsam haben?
Das Kommentieren von Körpern. Und darüber müssen wir auch – oder gerade – im feministischen Kontext sprechen. Lookism, der die Stereotypisierung beziehungsweise Diskriminierung aufgrund des Äußeren beschreibt, gibt es seit jeher, überall, gesamtgesellschaftlich wie auch unter Feminist:innen – genau wie die entsprechenden Gegenbewegungen. Hier ein kleiner historischer Abriss dazu:
Am Beginn stand die Fat-Acceptance-Bewegung der 60er Jahre. Sie wurde erst „Fat Power“, „Fat Liberation“ oder „Fat Pride“ genannt und setzte sich gegen die Diskriminierung fetter Menschen ein. Der Begriff „fett“ wurde von der Fat-Acceptance-Bewegung zurückerobert und gilt als Selbstbezeichnung
Aus der Fat-Acceptance-Bewegung entwickelte sich die Body Positivity, die als empowernd gelten sollte. Doch auch bei ihr steht die Schönheit im Vordergrund. Daraus erwuchs die Frage, wie man sich in einer (neo)kolonialen, sexistischen und kapitalistischen Gesellschaft schön finden soll, wenn man die ganze Zeit vorgebetet bekommt, dass Schönheit weiß, dünn und normschön und man ab Größe 42 Plus Size ist, obwohl die Mehrheit der weiblich gelesenen Personen diese trägt.
Um diesem Problem zu begegnen, wurde der Begriff der Body Neutrality eingeführt, der den Körper als Mittel zum Leben darstellt – denn dafür ist er da. Damit wir essen, trinken, schlafen, uns fortpflanzen und bewegen und ausdrücken können. Er ist nicht dazu gemacht, schön zu sein, sondern uns eine Existenz zu ermöglichen.
Diese Bewegungen sollen auf Probleme am Arbeitsmarkt, im Gesundheitssystem und in der Modewelt hinweisen. Alles, was von der Normschönheit abweicht, also haariger, nicht weiß oder nicht sportlich und schlank ist, wird geächtet. Mehrgewichtige Menschen werden seltener befördert, im Gesundheitssystem weniger ernst genommen und können oft nicht einmal shoppen gehen, weil kaum ein Geschäft mit Größen über 42 ausgestattet ist. Von der eigenen, internalisierten Fatphobia ganz zu schweigen.
„Strukturelle Probleme können nur im Kollektiv in Angriff genommen werden, nur zusammen können wir es schaffen.“
Auch in der feministischen Bubble werden unsere Körper oft unter die Lupe genommen und bewertet, wenn vielleicht auch unbewusst. Vor allem von uns Feminist:innen wird erwartet, den eigenen Körper zu wertzuschätzen, sich selbst zu lieben und zu feiern. Und wenn wir das nicht tun, dann tun wir zu wenig für unsere Sache, dann stehen wir nicht für unsere Werte ein. Aber das ist anstrengend. Und das funktioniert nicht immer in einer Gesellschaft, die uns das Gefühl gibt, zu viel zu sein. Niemand liebt sich selbst 24/7. Und es ist okay, den Feminismus so zu leben, wie er sich richtig anfühlt. Das kann sein, ins Fitnessstudio zu gehen und sich einen Podcast über Body Positivity anzuhören. Oder eine Saftkur zu machen und sich am zweiten Tag McDonald’s reinzuhauen. Oder sich an einem Tag wie ein:e fucking God(dess) zu fühlen und an einem anderen das Bett nicht verlassen zu wollen, weil keine Jeans sitzt. Das ist menschlich. Das sind wir. Und so ist auch unser Feminismus – so ernüchternd und schön und empowernd, wie wir ihn wollen. Doch vor allem ist er eines: sehr individuell. In der feministischen Bubble muss auch das erst ankommen. Kein Verurteilen, wenn sich jemand als Feminist:in bezeichnet und trotzdem auf Kohlenhydrate verzichtet, oder, the other way round, nur Junk-Food isst.
Es ist klar, dass sich vieles verändern muss: im Gesundheitssystem, auf dem Arbeitsmarkt, auf der individuellen Ebene sowie auf sozialen Medien oder diversen Dating-Apps. Doch strukturelle Probleme können nur im Kollektiv in Angriff genommen werden, nur zusammen können wir es schaffen. Ob haarig oder glattrasiert, ob mehrgewichtig oder schlank, ob BIPoC oder weiß, egal, welches Geschlecht – es gibt gesamtgesellschaftliche Probleme, die wir als solche anerkennen müssen. Als intersektionale Feminist:innen müssen wir Lookism als Kategorie betrachten, die bekämpft werden muss, denn wir alle leiden, egal in welcher Form, unter Stereotypisierungen und Vorurteilen. Also lasst uns den Mund aufmachen, lasst uns Marken boykottieren, die nicht inklusiv denken, lasst uns gemeinsam laut, gemeinsam aktiv und gemeinsam stark sein. Und let me tell you as a feminist: Manchmal ist es auch okay, sich unter der Bettdecke zu verkriechen, weil man sich nicht wohlfühlt.
Photos: © Monika Kozub