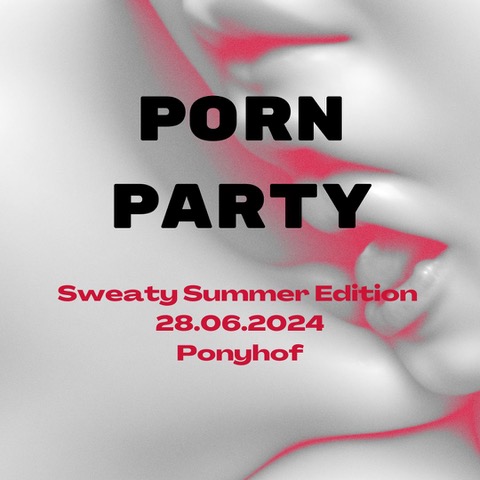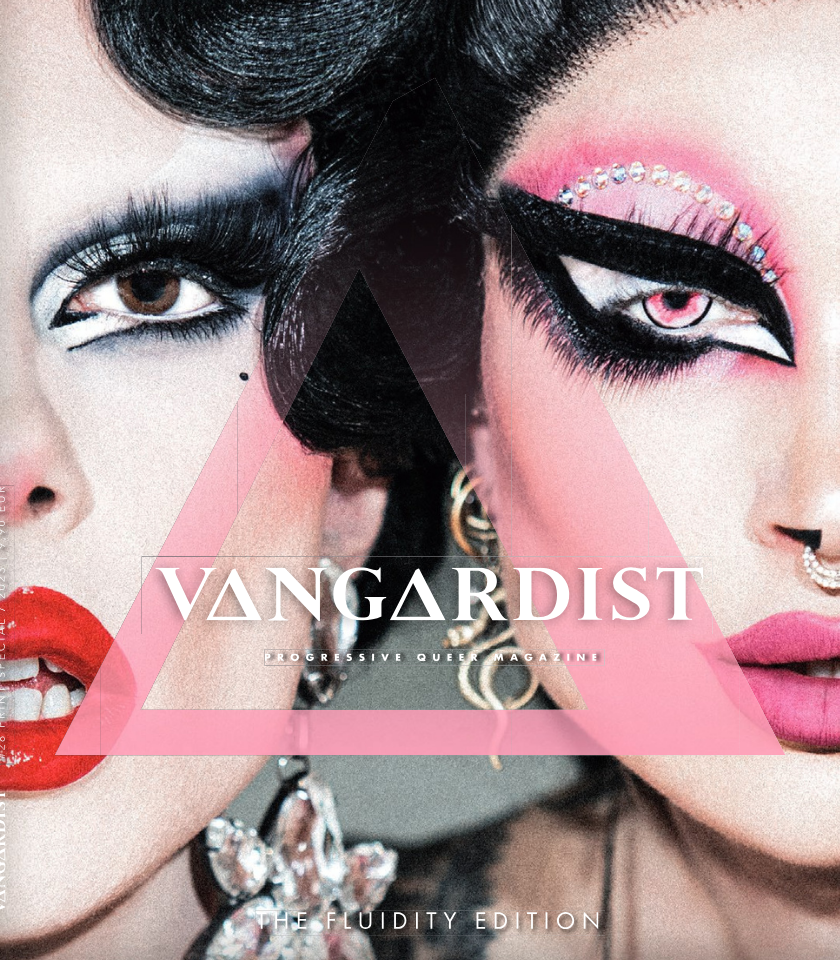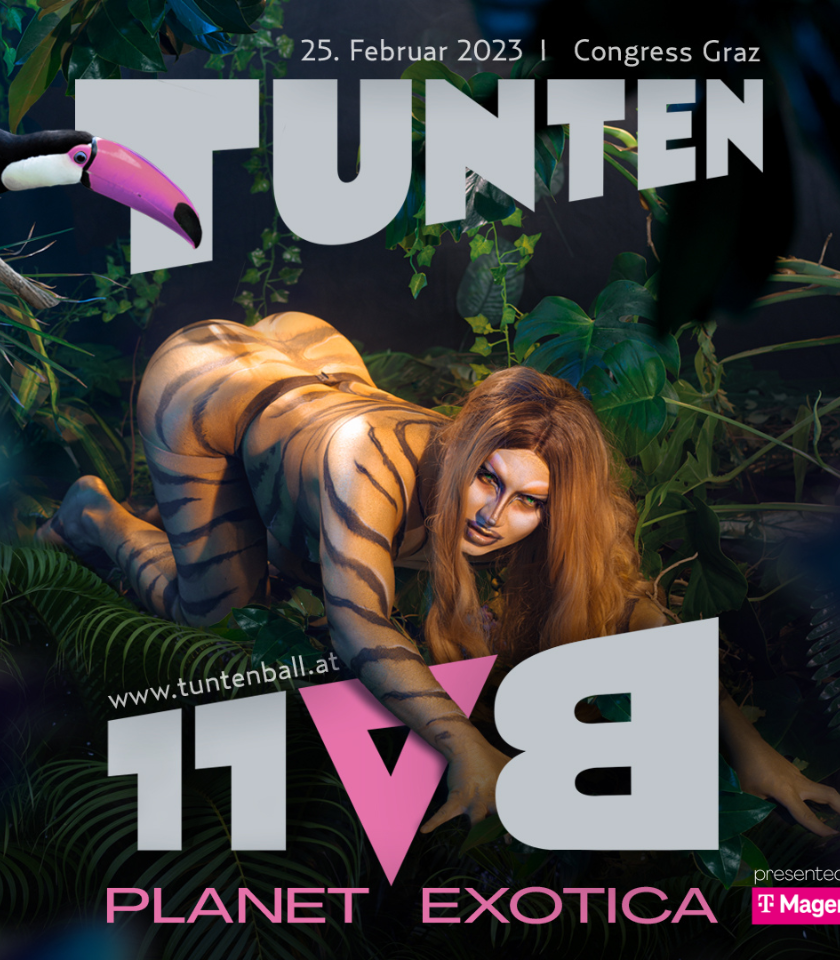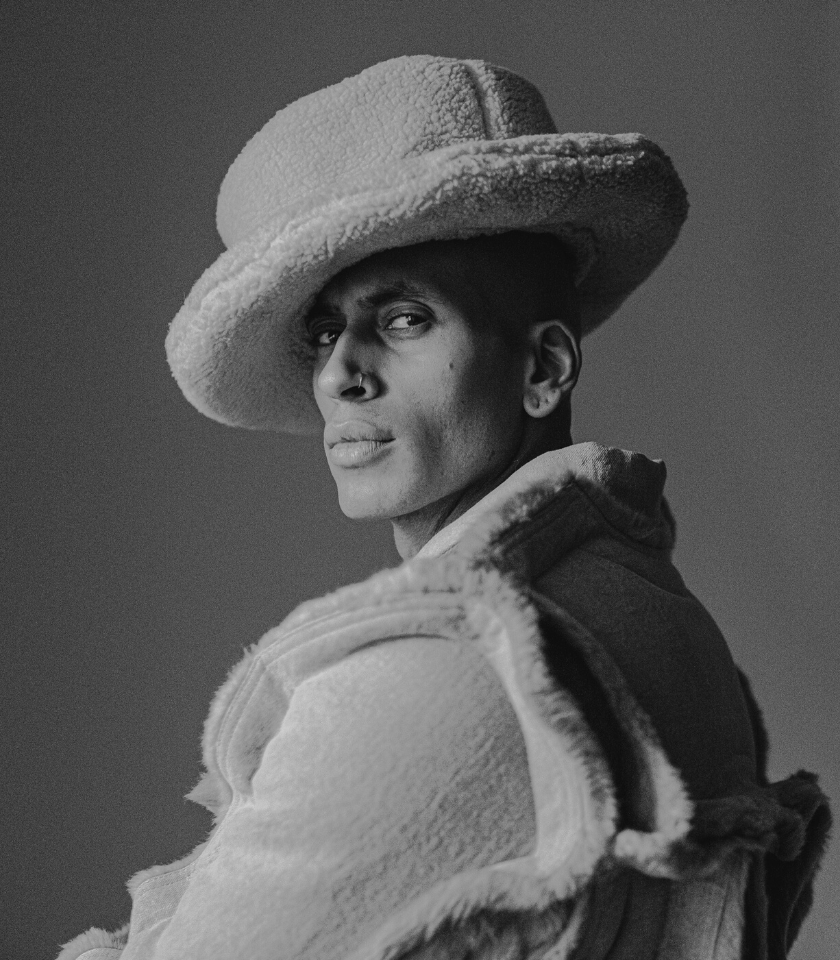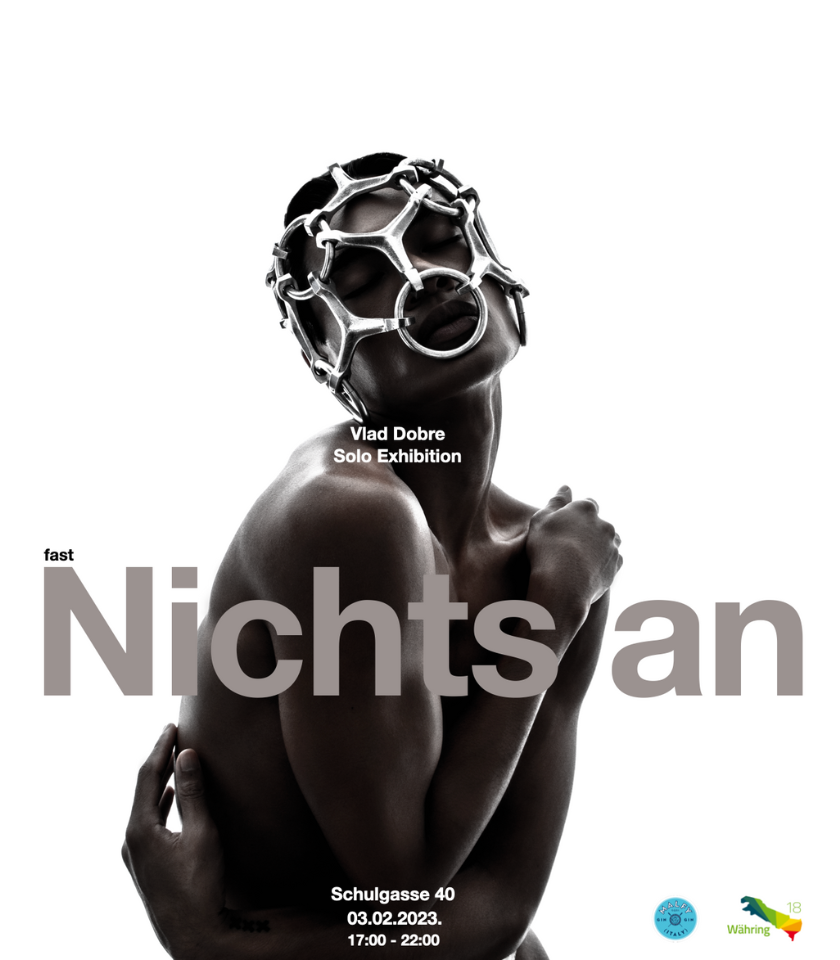Was bedeutete es, in den 1960er Jahren queer zu sein? In unserer Reihe Queer History informieren wir euch über die Generationen, die die ersten Schritte in Richtung Gleichberechtigung gewagt haben:
Anfang der 1960er Jahre setzten sich Homosexuelle nach und nach für ihre Rechte ein. Personen, die ihre sexuelle bzw. geschlechtliche Identität bis zu dieser Zeit privat hielten, wurden dazu inspiriert sie offen zu zeigen. Coming out war somit ein zentraler Begriff dieser Bewegung, um die von Unterdrückung und Geheimhaltung der eigenen Identität geprägten 1950er Jahre zu durchbrechen.
Es formierten sich viele politische sowie soziale Gruppen, die sich für die Gleichberechtigung queerer Personen (vor allem schwuler und lesbischer) einsetzten. Dies machte sich auch in der Filmszene bemerkbar, denn vor den 60er Jahren war Homosexualität in Filmen kaum präsent. 1961 lies die Gesetzgebung erstmals zu, dass Homosexualität in Filmen thematisiert werden darf, jedoch musste ein Film vor der Veröffentlichung freigegeben werden. Diese Regel führte dazu, dass vorwiegend Filme, welche diese Art der sexuellen Orientierung als nicht lebenswert darstellten, erlaubt wurden. Homosexualität wurde oftmals als Krankheit thematisiert, auch ein Leben geprägt von Einsamkeit und Mitleid waren beliebte Darstellungsformen.
Queere Charaktere wurden oft Objekte der Lächerlichkeit, wodurch homosexuelle Anspielungen in Sex-Komödien der 1960er Jahre keine Ausnahme waren. Auch in Action- und Abenteuerfilmen fanden LGBTQ-Personen ihren Platz in negativ behafteten Rollen, unter anderem als Schurken und Bösewichte.
Einer der berühmtesten Filme The Killing of Sister George, stellte Homosexualität aus heutiger Sicht sehr stereotypisch dar, jedoch portraitierte der Film ein Stück Realität von queeren Personen der 60er Jahre. Im Gegensatz zu anderen Filmen, beschäftigte sich die Handlung mit Beziehungen, dem Leben, Homophobie und dem nun öffentlichen Leben von nicht heteronormativen Personen. Viele Filmproduzenten der Avantgarde waren Teil des Underground Film Movements, welches einige Skandale auslöste – aber auch eine Stimme für alle queeren Personen war.
Flesh, Trash, Heat hießen die Filme der Trilogie, die einen wesentlichen Schritt zur sexuellen Revolution der späten 60er Jahre beitrug. Protagonist in allen drei Filmen ist Joel Dallesandro, auch unter dem Namen „Little Joe“ bekannt. Durch seine Rolle und sein Leben in den besagten Filmen wurde er zum Sexsymbol der späten 60er Jahre, und Gesicht der Hippie- und Schwulenbewegung. Der Film Flesh stellt einen Tag im Leben des Strichers Joe dar, welcher von seiner Freundin gebeten wird, Geld für den Schwangerschaftsabbruch ihrer Geliebten aufzutreiben. Im Laufe des Films sieht man Joe, der seine Kollegen, Freunde und Freier trifft. Eine hohe Dialoglastigkeit und vor allem die scheinbare Aneinanderreihung verschiedener Akte ohne wirklichen Zusammenhang, ohne überraschende Wendungen und ohne Sinn zeichnen den Film aus.
HIER geht’s zu #2 der Queer History Reihe.
Text: Sophie Wolge, Lisa Habegger und Lena Schuller
Lektorat: Alex Baur