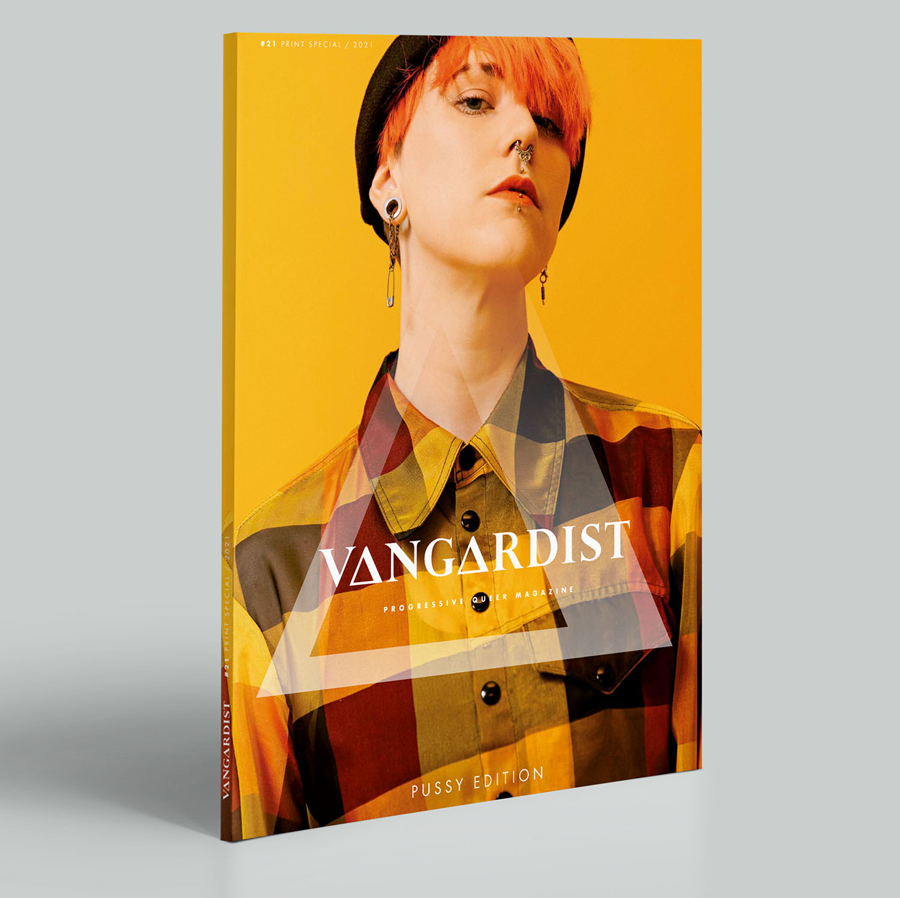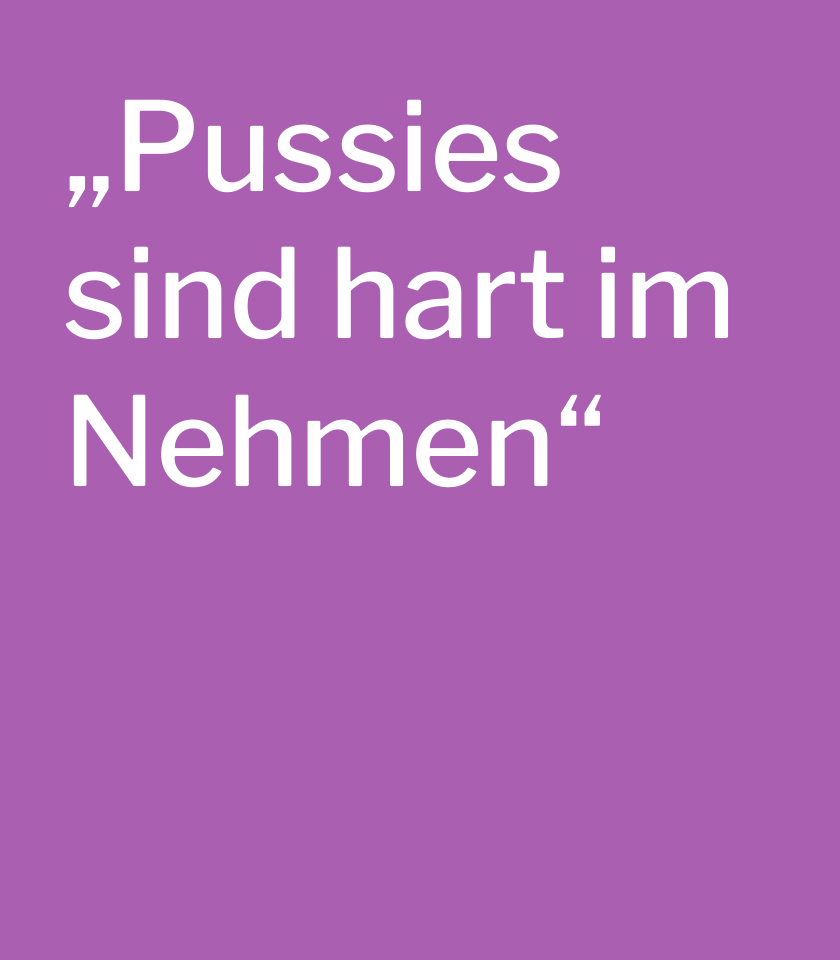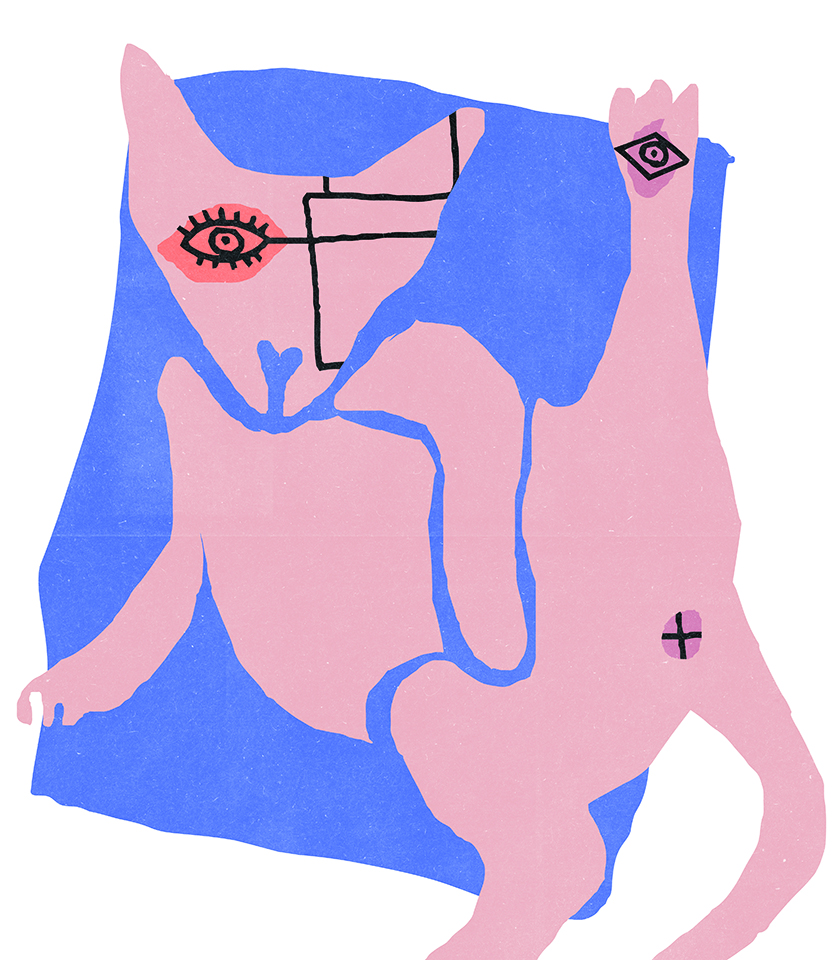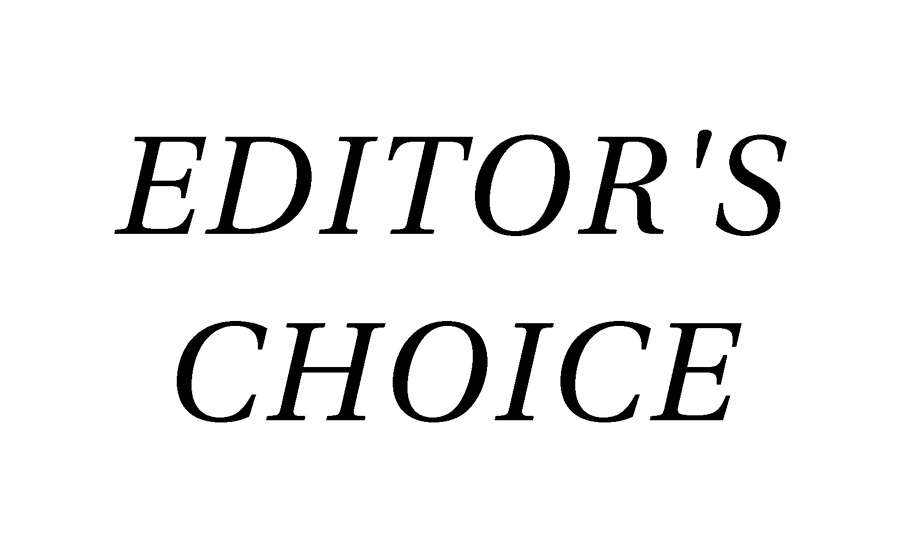Im Diskurs über die Lebensrealitäten von FLINTA* werden sie gerne vergessen – und doch gehören sie dazu: Sexarbeiter:innen. Die Nationalratsabgeordnete und Integrationssprecherin der Grünen Faika El Nagashi legt den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf Antirassismus, Intersektionalität und Antidiskriminierung. Schon bevor ihre politische Karriere begann, forschte sie zu Sexarbeit und Migration. Im Interview spricht sie mit uns über die Rechte von Sexarbeiter:innen, sexuelle Selbstbestimmung und ihren Werdegang als lesbische Politikerin mit muslimisch und ungarisch-ägyptischem Familienbezug.

Was bedeutet für Sie Freiheit?
Freiheit ist schwer fassbar. Sie ist für mich ein selbstbestimmter Gestaltungsraum, was meine Lebensführung anbelangt. Dabei eine Wahl zu haben und Entscheidungen treffen zu können. Dazu gehören aber ausreichend Ressourcen und Rechte: für Mobilität, für den Schutz vor Diskriminierung und Verfolgung, für eine finanziell abgesicherte Existenz, für den Zugang zu einer adäquaten Gesundheitsversorgung, für die Teilhabe an Bildung, Kultur und Politik. Freiheit ist für mich die Möglichkeit einer selbstbestimmten Lebensführung in einer Gesellschaft, die dafür die Rahmenbedingungen schafft.
In unserer aktuellen Ausgabe geht es um Empowerment und FLINTA*, die stetig für sich einstehen und um ihre Rechte kämpfen. Wie gehören sexuelle Selbstbefreiung, Sexarbeit und intersektionaler Feminismus zusammen? Was verstehen Sie unter diesen Begriffen?
Intersektionaler Feminismus ist für mich eine Analysekategorie. Ein Brennglas, das den Blick auf Phänomene schärft und diese zu verstehen hilft. Wie eben die Sexarbeit. Um die Realität der Sexarbeit in Österreich, aber auch in anderen Ländern des Westens zu verstehen, ist es unumgänglich, die Migrationsbewegungen aus den Ländern des globalen Südens in den globalen Norden zu berücksichtigen. Die Arbeitsmigration von Frauen auf der Suche nach Lebensperspektiven, nach Überlebensperspektiven. Die patriarchalen und heteronormativen Strukturen in Herkunfts- und in Zielländern. Den strukturellen Ausschluss und die Verhinderung von Mobilität, von Erwerbsmöglichkeiten, von politischer Partizipation. Den Rassismus und die Diskriminierung gegenüber Migrant:innen in Österreich und das – weltweite – Stigma gegenüber Sex Workern. Die Ausbeutung durch internationale Unternehmen, durch Sektoren im Tourismus, der Hotellerie, des internationalen Finanzverkehrs, die erst durch die massiven Abhängigkeiten und die oftmalige rechtliche Illegalisierung und Kriminalisierung möglich werden. Die Vulnerabilität der LGBTQIA+ Communities und die Unsichtbarkeit von Sexarbeiter:innen und ihren Bedürfnissen in der gesellschaftlichen und politischen Debatte. Und nicht zuletzt die Reglementierung und gesundheitspolizeiliche „Behandlung“ der Körper, der Sexualität, der Selbstbestimmung von Sexarbeiter:innen unter dem Vorwand der öffentlichen Gesundheit. All das kann ich mit einem intersektionalen feministischen und damit auch antirassistischen Zugang verbinden und begreifen. Und daraus leite ich meine Ansätze ab, um die Betroffenen zu stärken, zu ermächtigen und das System zu verändern.
“Menschen wie ich sind in der
österreichischen Politik nicht vorgesehen.”
Wie haben Sie als lesbische Politikerin mit muslimischen sowie
ungarisch-ägyptischen Wurzeln Differenzierungen in Gesellschaft,
Politik und ihrem persönlichen Werdegang gespürt?
Menschen wie ich sind in der österreichischen Politik nicht vorgesehen. Ich störe das System mehr, als dass ich mich darin einfüge. Und das ist gut so. Aber meine Identität an sich ist noch nicht revolutionär. Ich hoffe, dass der Unterschied in meiner politischen Arbeit erkennbar ist und in meiner Art, Politik zu machen. Ich bin in vielen Communities verankert und sehe sie und die Menschen darin als diejenigen, denen gegenüber ich Verantwortung trage. Mein Blick ist viel stärker dorthin gerichtet, als darauf, das politische System durch Angepasstheit oder Erfolg zu beeindrucken. Das hat natürlich seinen Preis. Aber Politik ist für mich nicht Selbstzweck. Ich vereine in meiner Familiengeschichte, in meiner Biografie, in meiner politischen Arbeit viele Themen, die so nicht zusammen gedacht werden. Bei meinem muslimischen Vater mein Coming-out als Lesbe zu haben war ein langer Weg und hat mir letzten Endes gezeigt, dass sich diese zwei Sphären nicht ausschließen müssen. Und dass wir diese Räume, in denen wir mehr Gemeinsames als Trennendes finden können, selbst schaffen müssen. Räume für Antirassismus in queeren Kontexten, für LGBTQIA+ Rechte in konfessionellen Communities, für eine politische Betrachtung von Diversität im linken Spektrum. Das bedeutet für mich, die Anerkennung unserer unterschiedlichen Betroffenheiten. Und auch die Frage danach, für wen wir eigentlich Politik machen.
Was verstehen Sie unter sexueller Selbstbefreiung?
Ich kann mit Selbstbestimmung etwas mehr anfangen. Die Selbstbefreiung ist für mich ein Prozess hin zur Selbstbestimmung. Es ist die beginnende Reflexion der Verhältnisse, unter denen wir leben. Das Infragestellen eben dieser und das Denken und Finden von Alternativen. Sexualität ist gesellschaftspolitisch nicht neutral. Sie wird immer noch primär als heterosexuell und in einer Geschlechterbinarität verortet gedacht und alles, was davon abweicht, ist eben (nur) eine Abweichung. Sexuelle Selbstbefreiung nicht nur individuell, sondern gesellschaftlich und strukturell zu denken, ist notwendig, um nicht nur auf der Ebene individueller Lebensentwürfe eine Vielfalt zu ermöglichen, sondern als Gesellschaft wirkliche Entfaltungsfreiheit anzubieten.
Sehen Sie in den verschiedenen Communities hier Differenzen in Bezug auf dieses Thema?
Ja, das Thema Sexualität nimmt in den verschiedenen Communities, in die ich eingebunden bin, einen unterschiedlichen Stellenwert ein und hat eine unterschiedliche politische Geschichte. Da die Sexualität der LGBTQIA+ Community über viele Jahrzehnte durch Gesetze reguliert und kriminalisiert wurde, entstanden hier ganz andere politische Kämpfe um die sexuelle Selbstbestimmung.
“Wenn wir unsere Kämpfe nebeneinander führen oder gar gegeneinander, verlieren wir die Kraft, die wir für Systemveränderung brauchen.”
Gehören die Gleichstellung der Geschlechter und der Kampf der LGBTQIAs zusammen?
Teilweise. Aber es gibt unterschiedliche Themen, Zugänge und Schwerpunktsetzungen – auch innerhalb der Communities. Manche zielen auf Gleichstellung innerhalb des bestehenden Systems ab, also auf eine Erweiterung ihrer eigenen Freiheiten und Möglichkeiten. Andere arbeiten für eine Änderung des Systems und damit für mehr Freiheiten und Möglichkeiten für mehr Menschen. Die einen beziehen sich stark auf bestehende Geschlechterkategorien, die anderen verändern und erweitern diese. Was sie verbindet ist, dass sie auf der einen oder anderen Ebene Machtverhältnisse ansprechen und sichtbar machen – ein wichtiger Schritt für mehr Inklusion und soziale Gerechtigkeit.
Inwieweit beeinflussen sich diese beiden Bewegungen und
was bedeutet für Sie Allyship in diesem Zusammenhang?
Wir alle sind miteinander verbunden. Ubuntu. Eine südafrikanische Bezeichnung für das Bewusstsein, selbst Teil eines Ganzen zu sein. Wenn wir unsere Kämpfe nebeneinander führen oder gar gegeneinander, verlieren wir die Kraft, die wir für Systemveränderung brauchen. Allyship verstehe ich dabei als politische Verbundenheit, die sich auf gemeinsame Ziele gründet; trotz aller Unterschiedlichkeiten im Zugang. Diese Art der Bündnispolitik versuche ich selbst in meiner politischen Arbeit zu leben und zu unterstützen.
Sie haben zum Thema Sexarbeit und Migration geforscht. Was muss gesellschaftlich und politisch passieren, damit Sexarbeit als „ordentlicher Beruf“ angesehen wird?
Die große Herausforderung im Bereich der Sexarbeit ist für mich die Doppelmoral. Die gesellschaftliche Stigmatisierung von Sexarbeiter:innen, die eine sehr lange Geschichte im Patriarchat hat und damit in der Kontrolle von Frauen und von weiblicher Sexualität. Das sogenannte „Huren-Stigma“ ist eines, das Frauen jederzeit treffen kann, unabhängig davon, ob sie Sexarbeiterinnen sind. In der Geschichte wurde es gegen alleinstehende Frauen verwendet, gegen wiederverheiratete, gegen allein reisende Frauen, gegen Frauen in bikulturellen Beziehungen, gegen Frauen, die Hosen getragen haben und gegen Frauen, die keine Hosen getragen haben. Es ist ein Instrument des Patriarchats zur Einzementierung der Machtverhältnisse. Ebenso richten sich alle Reglementierungsmaßnahmen an diejenigen, die in der Sexarbeit tätig sind. Nicht an das Umfeld – die Lokale, Bars, Betreiber:innen – oder diejenigen, die die Dienstleistungen von Sexarbeiter:innen in Anspruch nehmen. Verpflichtende Gesundheitsuntersuchungen treffen Sex Worker, ebenso eine mitunter polizeiliche Registrierung, die gesellschaftliche Abwertung und Geringschätzung, der politische Ausschluss. Die sexuellen Tabus der Gesellschaft werden Sexarbeiter:innen umgehängt und Maßnahmen drum herum entwickelt, die nach Außen den Anschein einer Gesellschaft wiedergeben, in der es dieses Phänomen nicht gibt. In der nicht mehrheitlich Männer als Kunden die Dienstleistungen von Sexarbeiter:innen in Anspruch nehmen würden. Nachbarn, Kollegen, Väter, Brüder, Partner, Ärzte, Lehrer, Politiker, Installateure, Kellner, Taxifahrer, Pensionisten, Manager, Aufsichtsräte. Darüber wird geschwiegen. Das zeigt die sexuelle Doppelmoral der Gesellschaft auf.
Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen der aktuellen Gesetzeslage bezüglich Sexarbeiter:innen und der Tatsache, dass die meisten von ihnen Migrant:innen sind?
Ja, selbstverständlich. Warum bekommt das Thema keine politische Relevanz? Warum wird es immer wieder zu einer Diskussion, die Sexarbeiter:innen entweder zu Opfern oder zu Täter:innen macht? Wo ist die Agency und warum wird diese Subjektposition Migrant:innen nicht zugesprochen? Und wo sind die Solidarisierungen? Zusätzlich zu den jeweiligen Prostitutionsgesetzen erschweren die Migrationsgesetze, das Fremdenrecht, die so genannten Integrationsvereinbarungen die Situation. Die Abwertung gegenüber Migrant:innen in der Sexarbeit ist eine, die sich aus Rassismus, Sexismus und dem „Huren-Stigma“ speist. Eine widerliche Geringschätzung gegenüber Menschen, deren „Verbrechen“ es ist, Grenzüberschreiter:innen des Erlaubten zu sein und sexuelle Dienstleistungen gegen Entgelt anzubieten.
Text von Solomon Osei-Tutu & Iris Poltsch
Photos: Murtaza Elham, Parlamentsdirektion / Thomas Topf, Jakob Alexander