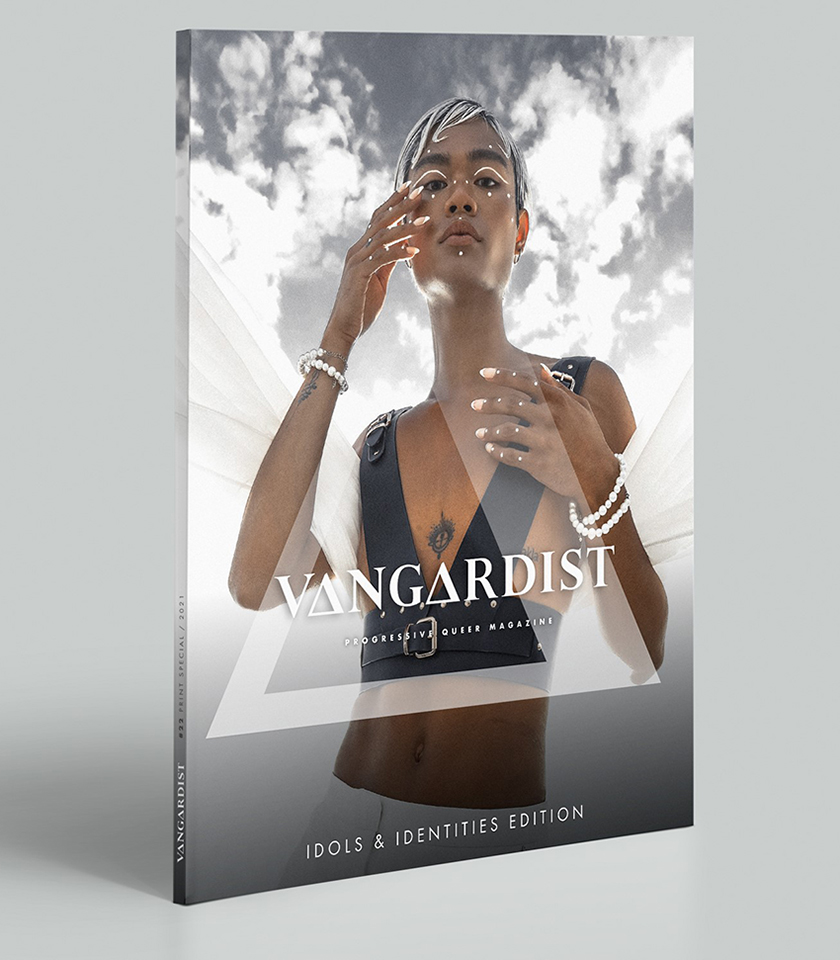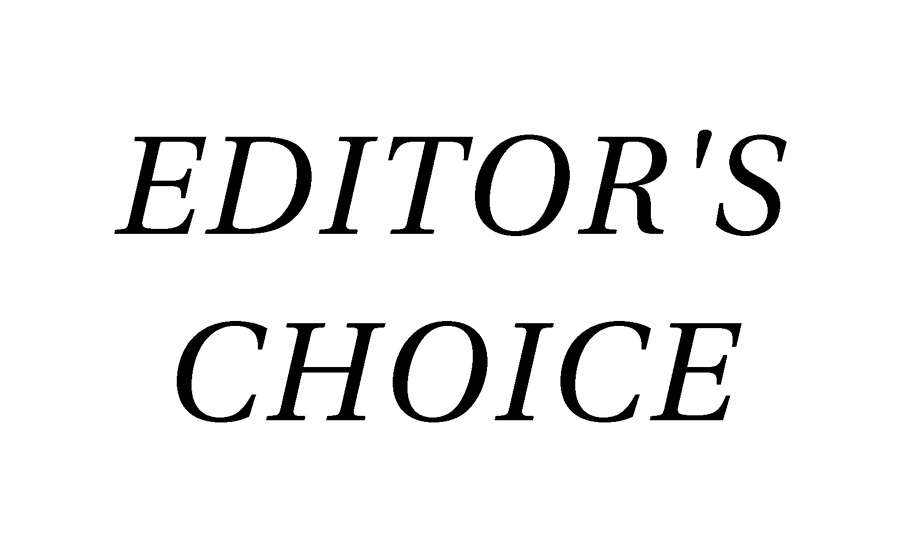Ob Christus, Hitler, Gandhi oder Freddy Mercury – wer wir sind und was wir sein wollen, kommt nicht nur aus uns selbst, sondern orientiert sich seit jeher an außergewöhnlichen Leitbildern, die – im Guten wie im Schlechten – vorleben, was möglich ist. Gerade traditionell marginalisierte Gruppen wie die LGBTQIA+ Community sind auf starke Role Models angewiesen, um in einem repressiven Umfeld ihre Identität zu formen und zu behaupten. Aber was, wenn es so viele Idole gibt, dass irgendwann kein ,Wir’ mehr möglich ist, sondern einzig und allein das ,Ich’ bestehen bleibt?
Wer bin ich?
Als LGBTQIA+ haben wir auf die harte Tour gelernt, der Mainstream-Gesellschaft unser individuelles ,Anderssein’ entgegenzuhalten. Sein wahres inneres Selbst zu entdecken, es zuzulassen und auszuleben ist der Weg, den wir alle gehen mussten oder noch müssen, um unsere Identität und damit unser Lebensglück zu finden. Die Konstruktion eines erwachsenen Ichs, das mit sich selbst zumindest einigermaßen im Einklang steht, ist eine psychische Entwicklungsleistung, die jeder Mensch – egal ob Weiß oder People of Color, hetero oder queer – für sich erbringen muss. Mutige Vorbilder, Role Models, ja, Idole, spielen da eine wichtige Rolle. Zuerst einmal sind das natürlich Personen der engeren Umgebung. Mama, Papa, die allen Widrigkeiten trotzende Oma, der seine Träume verfolgende Opa. Ist man diesem Basic Training der Persönlichkeitsbildung entwachsen, wird die Frage „Wer bin ich?“ zusehends weiter gefasst. In dem Ausmaß, in dem man seine Eigenheiten entdeckt, stellt sich die Frage, wer man in Bezug auf die Gesellschaft, in der man lebt, ist beziehungsweise sein möchte. Und hier reichen die Vorbilder aus dem unmittelbaren Umfeld nicht mehr aus. Nicht zuletzt, weil man sich ja irgendwann gegen die eigenen Eltern behaupten muss.
Straight oder Gay?
An diesem Punkt im Leben beginnt man, sich mit den massenmedial transportierten Idolen des öffentlichen Lebens zu identifizieren: ,Larger than Life’-Figuren aus (Pop-)Kultur, Sport und Politik, die ostentativ gewisse Haltungen, Meinungen und Eigenschaften zur Schau stellen, die man in sich selbst zu spüren meint. Gleichzeitig beginnt sich hier ein unauflösbarer innerer Kampf zu manifestieren zwischen dem Bedürfnis, einzigartig zu sein und gleichzeitig Teil eines bedeutungsvollen, größeren Ganzen zu werden. Bis vor nicht allzu langer Zeit war die Sache relativ übersichtlich – Beatles oder Stones, rechts oder links, straight oder gay. Hatte man keine gröberen Schwierigkeiten mit der Beschaffenheit seines gesellschaftlichen Umfeldes, war man spätestens mit Ende seiner biologischen Pubertät ein Teil von etwas geworden, das wir auch heute noch als sozialen Mainstream bezeichnen würden. Wenn man hingegen das Gefühl bekam, aufgrund gewisser Eigenschaften nicht dazuzugehören, identifizierte man sich mit den Idolen der Gegenkulturen und wurde Teil einer solchen. Schillernde Persönlichkeiten – von Martin Luther King über Marsha P. Johnson bis Madonna – waren für die Bildung solch kollektiver Identitäten unverzichtbar.
“Wir wollen uns nicht länger in Schubladen stecken lassen,
sondern als Individuen wahrgenommen werden,
die ein Recht auf Glück und Selbstverwirklichung haben.“
Diversität und Digitalisierung
Waren es bis vor zwei Jahrzehnten nur wenige Figuren des öffentlichen Lebens, die für eine solche Form der Identitätsstiftung infrage kamen, haben die Digitalisierung und der Siegeszug von Social Media unser Verständnis von Öffentlichkeit radikal auf den Kopf gestellt. Plötzlich konnte Sichtbarkeit nicht mehr nur von ,oben nach unten’ erreicht werden, sondern auch von ,unten nach oben’. Gemeinsam mit einer Ideologie des radikalen Individualismus, die sich ab Mitte der 1980er-Jahre in der gesamten sogenannten westlichen Welt etabliert hatte, war eine ganze Generation von Digital Natives plötzlich in der Lage, zu Personen des öffentlichen Lebens zu werden. Für die Sichtbarkeit von Diversität in unseren Gesellschaften war das natürlich großartig. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit konnte man sich an einem derart großen Pool an unterschiedlichen Vorbildern bedienen. Denn bei allem politischen Erfolg, wie etwa der Gay-Rights-Bewegung, waren es doch primär weiße, homosexuelle Männer, die mal mehr, mal weniger als Idole für alles, was nicht bürgerlich und hetero war, herhalten mussten. Dass dabei die Repräsentation der Ls und Bs und Ts und Qs zu kurz gekommen ist, liegt auf der Hand.
Schöne neue Welt
Im Jahr 2021 ist das anders. Unter der Fahne des Regenbogens versammelt sich eine Vielzahl höchst spezifischer Partikular-Identitäten, die – zumindest in den westlichen Industriegesellschaften – primär um Anerkennung und Respekt, um ,Recognition’, kämpfen. Wir wollen uns nicht länger in Schubladen stecken lassen, sondern als Individuen wahrgenommen werden, die ein Recht auf Glück und Selbstverwirklichung haben. Das Mittel der Selbstdarstellung im Netz ist da ein wirkungsvolles Instrument. Zuerst einmal als Self-Empowerment – hat man den Mut gefunden, offen dafür einzustehen, wer man ist, kann man das via Social Media auch zeigen und entsprechenden Support von Gleichgesinnten und Verbündeten erhalten. Gleichzeitig gibt man damit aber auch etwas zurück, indem man selbst zum Role Model für andere wird, die sich durch mutiges Zurschaustellen von Individualität in ihrem eigenen Weg bestärkt fühlen. Im Zeitalter der sozialen Medien kann jeder zum Idol werden. Zumindest innerhalb der Bubble, die uns Facebook, Instagram & Co. als Öffentlichkeit präsentieren.

Bubblification der Öffentlichkeit
So großartig die Niederschwelligkeit auch ist, mit der wir alle Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit erreichen können, hat diese digitale Individualisierung aber auch ihre Schattenseiten. Es ist viel von der ,Community’ die Rede, doch in Wirklichkeit wissen die Einen oft recht wenig von den Anderen. Das hat nicht nur etwas mit Narzissmus zu tun, wie uns von politisch Rechts her gerne unterstellt wird, sondern auch mit der Beschaffenheit der Social Media, wie wir sie alle nutzen. Selbst reichweitenstarke Online-Persönlichkeiten sprechen in Wahrheit nur einen verschwindend kleinen Teil all jener Menschen an, die im weiteren Sinne unter LGBTQIA+ zusammengefasst werden könnten. Es ist kein Zufall, dass unser regenbogenfarbenes Akronym von Jahr zu Jahr um einen weiteren Buchstaben des Alphabets ergänzt wird. Im Jahr 2021 gibt es nicht mehr nur die ,eine’ Öffentlichkeit, sondern unendlich viele kleine, die von den Algorithmen des Silicon Valley spezifisch auf unsere Bedürfnisse nach Geltung zugeschnitten sind. Eine halbe Million Follower auf Instagram sind – global gesehen – nicht besonders viel. Zumindest, wenn es um handfeste politische Relevanz geht.
Solidarität vs. Individualität
Und hier kommt der innere Konflikt der Identitätsbildung auf einem ganz neuen Level wieder zum Tragen: Das Bedürfnis nach Sichtbarkeit und Anerkennung der individuellen Einzigartigkeit spießt sich mit der politischen Notwendigkeit, als Teil einer marginalisierten und noch immer diskriminierten ,Minderheit’ wirksam um politische Mitsprache zu kämpfen. Und auch, wenn ,wir im Westen’ es gerade relativ bequem haben und die Zeichen der Zeit trotz allem eher auf Fortschritt hindeuten, sind wir als LGBTQIA+ mitnichten an dem Punkt, den Kampf um Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung ausschließlich auf der identitätspolitischen Ebene zu führen. Das soll nicht heißen, dass die viel gescholtenen Identity-Politics kompletter Bullshit sind. Ganz im Gegenteil: Sie sind ein wirkmächtiges Instrument, um kulturelle Vorurteile abzubauen und eine tolerante, offene Gesellschaft nachhaltig zu etablieren. Aber wenn es um konkrete Politik geht, um den Kampf für Rechte und Gesetze und um sozioökonomische Gleichstellung, braucht es Solidarität über die eigene Partikular-Identität hinaus. Das war bei Karl Marx schon so und stimmt noch heute. Und dafür benötigen wir Vorbilder, Role Models, Idole, die in der Lage sind, Gemeinsamkeiten einer in vielerlei Hinsicht hoch diversen Community spürbar zu machen.
Photo Credits:
© Pexels (Cottonbro & Anete Lusina)